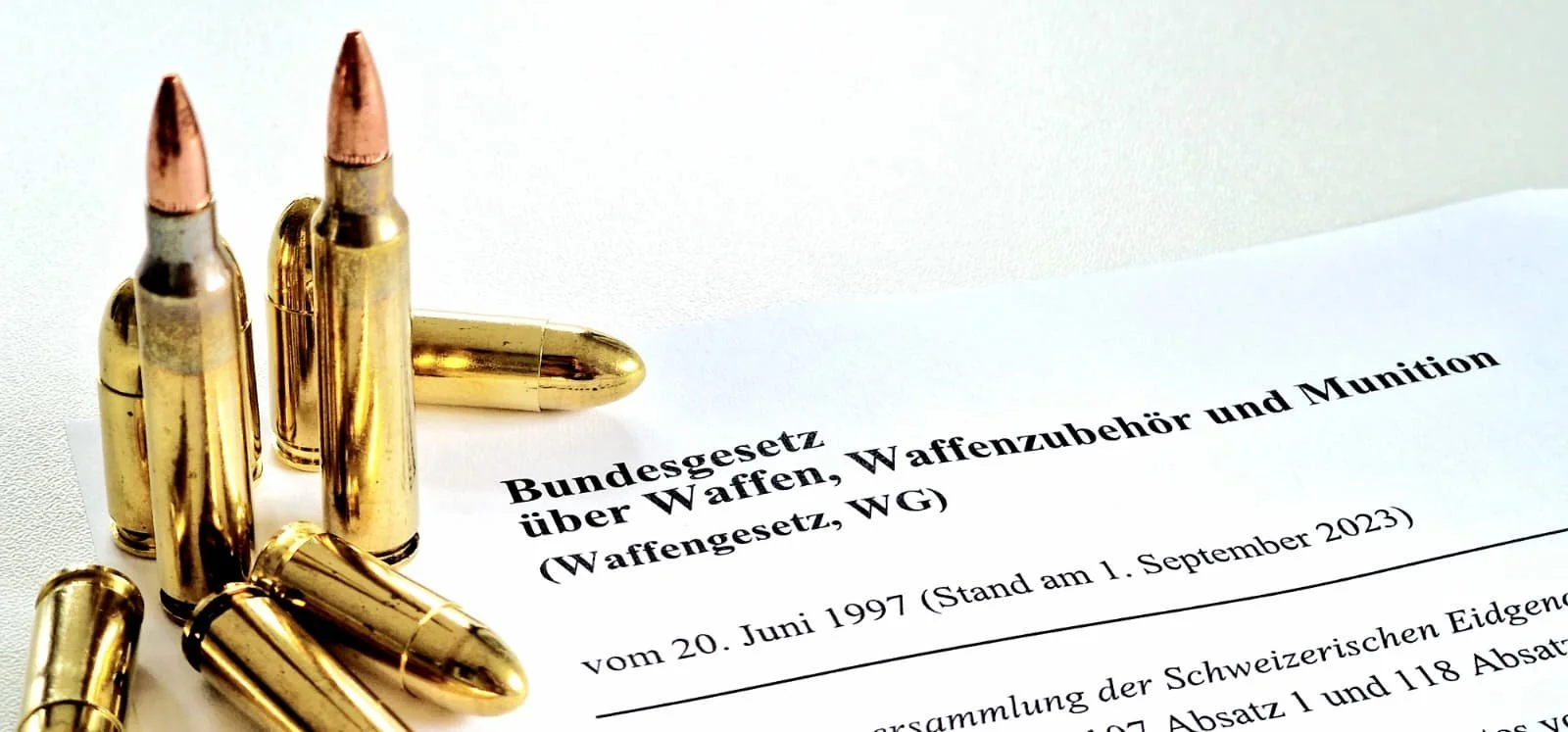Urteil des Bundesgerichts 2C_333/2025 vom 1. September 2025
Beantragung und Erhalt eines Waffenerwerbsscheins
Beschwerde gegen den Entscheid des Kantonsgericht des Kantons Waadt vom 19. Mai 2025
Sachverhalt
Die 2004 geborene und noch bei ihren Eltern wohnhafte Beschwerdeführerin beantragte am 21. März 2024 einen Waffenerwerbsschein (WES) im Kanton Waadt. Dem Antrag wurde unter Verweis auf eine Verletzung ihrer Mitwirkungspflicht nicht stattgegeben, da sie sich weigerte, der Einladung der Polizei zu einem persönlichen Gespräch zwecks Prüfung ihres Antrages nachzukommen. Auch den in Aussicht gestellte, optionale Besuch der Polizei bei ihr zu Hause lehnte sie ab. Sie verwies darauf, dass sie die Voraussetzungen für die Ausstellung eines WES erfülle und ein Gespräch sowie eine zusätzliche Kontrolle bei ihr zu Hause gegen das Verhältnismässigkeitsgebot verstossen.
Die Polizeit begründete ihr Vorgehen damit, dass erfahrungsgemäss das Risiko einer Selbst- oder Fremdgefährdung durch Waffen bei jungen Personen erhöht sei. Im Rahmen des kantonalen Verfahrens hielt die Polizei fest, es ginge lediglich darum, die betroffene Person zu treffen (was die Beschwerdeführerin grundsätzlich bereits ablehnte) und dann gegebenenfalls mit ihrer Zustimmung ihre Wohnung aufzusuchen, ohne über einfache visuelle Feststellungen hinauszugehen. Die Lebensweise bzw. der Besuch der Wohnung erlaube Rückschlüsse auf mögliche Probleme (z.B. psychische Erkrankungen, Substanzmissbrauch), die mit dem Waffenbesitz unvereinbar sind.
Streitgegenstand
Streitig und zu prüfen war, ob die Polizei zwecks Beurteilung des Risikos eines Waffenmissbrauchs die Beschwerdeführerin zu einem Gespräch einladen und ihr gestützt darauf einen (möglichen) Hausbesuch abstatten darf, zwecks Erteilung eines WES.
Rechtliche Grundlagen
Der Erwerb von Waffen und deren wesentlichen Bestandteilen ist im Bundesrecht geregelt: Gemäss Art. 8 Waffengesetz (WG) müssen alle Personen, die ein Waffe oder einen wesentlichen Waffenbestandteil erwerben, über einen WES verfügen. Abs. 2 dieser Bestimmung regelt, wer keinen WES erhält: Dies sind minderjährige und verbeiständete Personen oder Personen, bei denen zu befürchten ist, dass sie die Waffe in einer für sich selbst oder für andere gefährlichen Weise verwenden könnten (E. 4.2). Ob eine Selbst- oder Fremdgefährdung im Sinne von Art. 8 Abs. 2 lit. c WG anzunehmen ist, beurteilt sich anhand des Gesamtverhaltens der betroffenen Person unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände (vgl. Urteil des Bundesgericht 2C_586/2024 vom 11. Februar 2025 E. 4.1.2).
Die zuständige Behörde muss eine Prognose über das Risiko des Missbrauchs der Waffe treffen (Urteile des Bundesgerichts 2C_38/2025 vom 11. Juni 2025 E. 4.1; 2C_586/2024 vom 11. Februar E. 4.1.2). Da die Verweigerung eines WES auf der Grundlage von Art. 8 Abs. 2 Bst. c WG präventiven Charakter hat, dürfen keine zu hohen Anforderungen an die von der Person ausgehende Gefahr gestellt werden. Aufgrund der Umstände des konkreten Falles muss jedoch eine überwiegende und objektiv begründete Wahrscheinlichkeit bestehen, dass die Person durch den Gebrauch einer Waffe sich selbst oder andere gefährdet (E. 4.2; Urteile des Bundesgerichts 2C_38/2025, a. a. O., E. 4.1; 2C_586/2024, a. a. O., E. 4.1.3). Für die Durchführung dieser Überprüfung sind die Kantone zuständig (Art. 9 WG): Welche Beweismittel zulässig sind und wie die Behörde den für den Erlass einer Verwaltungsmassnahme relevanten Sachverhalt feststellt, ist Sache des Verwaltungsverfahrens, das grundsätzlich dem kantonalen Recht unterliegt (E. 6.4; BGE 139 II 95 E. 3.1; Urteil 1C_308/2024 vom 3. Dezember 2024 E. 7).
Erwägungen des Bundesgerichts
Das Bundesgericht hielt fest, dass es kein absolutes Recht auf den Erwerb einer Waffe gibt, sondern von einer Genehmigung durch die zuständige Behörde abhängig ist. Bei der Prüfung der Voraussetzungen für die Erteilung dieser Genehmigung müsse die Behörde eine Prognose über die Zuverlässigkeit des Antragstellers erstellen, wobei sie unter Berücksichtigung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit das Gesamtverhalten des Antragstellers und alle relevanten Umstände des konkreten Falles zu berücksichtigen habe (E. 5.2).
Das Bundesgericht folgte der Argumentation der Vorinstanz: Da sich die Polizei im vorliegenden Fall bezüglich ihres Vorgehens auf kantonales Recht stützte (Art. 28 ff. LPA/VD) und sowohl eine Anhörung als auch eine Besichtigung vor Ort sowie die Mitwirkungspflicht der antragsstellenden Person im kantonalen Recht vorgesehen sind, habe sie das Gesuch um Waffenerwerb zurecht abgewiesen. Ein Hausbesuch sei nicht von vornherein angeordnet worden, sondern würde erst in Aussicht gestellt werden, wenn das vorgängige Gespräch dazu Anlass gibt. Der Hausbesuch selber müsse auch dem Verhältnismässigkeitsprinzip entsprechen. Da die Beschwerdeführerin jedoch alle Untersuchungsmassnahmen abgelehnt hatte, die über die Einreichung ihres Antrags auf Erteilung eines WES hinausgingen, sei sie ihrer Mitwirkungspflicht bei der Sachverhaltsfeststellung nicht in dem von ihr zu erwartendem Umfang nachgekommen. Sie bringe keine praktischen Gründe vor, die sie am Gespräch mit der Polizei gehindert hätten. Ein Gespräch sei ein taugliches und verhältnismässiges Mittel um mögliche Ausschlussgründe für die Ausstellung eines WES - besonders bei so jungen Personen - zu eruieren. Die Polizei sei unter diesen Umständen berechtigt anzunehmen, dass die in den Akten verfügbaren Informationen nicht ausreichten, um eine Prognose über ein Missbrauchsrisiko der Waffe durch die Betroffene zu treffen und festzustellen, ob die gesetzlichen Voraussetzungen für die Erteilung des beantragten WES erfüllt waren. Die Polizei habe ihren weitreichenden Ermessensspielraum nicht überschritten (E. 6).
Es lasse sich zudem keine Absicht erkenne, dass die Polizei unabhängig vom Ergebnis der Anhörung der Beschwerdeführerin die Absicht hatte, ein Hausbesuch durchzuführen. Vielmehr sei davon auszugehen, dass nur dann, wenn bei der Anhörung Zweifel an der Zuverlässigkeit der Betroffenen im Sinne des Waffengesetzes aufgetreten wären oder nach der Anhörung bestanden hätten, ein Hausbesuch – in gerechtfertigter Weise – durchgeführt worden wäre, um diese Zweifel auszuräumen oder zu bestätigen (E. 6.6).
Das Bundesgericht wies die Beschwerde ab.
Einordnung des Urteils
Wird durch das Urteil ein Gespräch mit der Polizei und ein Hausbesuch vor jedem Waffenerwerb zum Standard?
PROTELL, ein gemeinnütziger Verein, der sich für ein liberales Waffenrecht einsetzt, befürchtet, dass dieses Urteil Bürgerinnen und Bürger, die künftig eine Waffe erwerben möchten, vom Kauf abschrecken könnte, weil sie “eine uniformierte Kontrolle in den eigenen vier Wänden zu dulden” hätten. Das Urteil betriff ein PROTELL-Mitglied, das durch ihre Rechtsschutzversicherung unterstützt wurde. Gemäss PROTELL verletzt das Urteil die verfassungsmässig geschützte Privatsphäre in krasser Weise. Ein gesetzlich vorgesehenes Recht - also das Recht eine Waffe zu erwerben - würde faktisch zu einem Privileg herabgestuft.
Ist dem wirklich so? Wird der Hausbesuch durch die Polizei (und ein Gespräch bei der Polizei) vor dem Erwerb einer Waffe mit diesem Urteil zum Standard? Nein, das wird es mit grosser Wahrscheinlichkeit nicht.
Behördlicher Ermessensspielraum
Wer in der Schweiz eine Waffe erwerben möchte, braucht einen Waffenerwerbsschein (WES). Achtung: Nicht für alle Waffen benötigt man einen WES, es gibt Ausnahmen. Am besten klärt man die Art der Bewilligung vor dem Kauf der Waffe mit dem Waffenbüro seines Wohnsitzkantons ab. Art. 8 Abs. 2 WG regelt, wer keine Waffe erwerben darf: Dies sind
Minderjährige und verbeiständete Personen (lit. a und b),
Personen, die zur Annahme Anlass geben, dass sie sich selbst oder Dritte mit der Waffe gefährden (lit. c) oder
Personen, die einen Eintrag im Strafregister haben (lit. d).
Während die Hinderungsgründe in lit. a, b und c relativ einfach, klar und eindeutig ohne grossen Aufwand feststellbar sind, fällt dies bei den Hinderungsgründen gemäss lit. c nicht mehr ganz so leicht, da die Behörde eine Prognose für die Zukunft bezüglich Selbst- oder Fremdgefährdung stellen muss. Eine Suizid- oder Drittgefährdung kann grundsätzlich nie restlos ausgeschlossen werden. Deshalb muss die Behörde im Einzelfall sorgfältig und aufgrund konkreter Umstände prüfen, ob bei einer Person Anhaltspunkte für eine Suizidgefahr vorliegen oder konkrete Hinweise dafür bestehen, dass keine Gewähr für einen sorgfältigen und verantwortungsbewussten Umgang mit der Waffe gegeben ist und deshalb Dritte gefährdet sind. Es wird kein strikter Beweis einer Selbst- oder Drittgefährdung verlangt, gleichzeitig wird aber immerhin mehr als ein bloss vager diesbezüglicher Verdacht vorausgesetzt. Es muss eine an konkrete Gegebenheit sachlich begründbare, überwiegende Wahrscheinlichkeit für eine Selbst- oder Drittgefährdung im Sinne einer Gefährdung der Sicherheit von Personen oder der öffentlichen Ordnung vorliegen, um den Hinderungsgrund nach Art. 8 Abs. 2 lit. c WG zu bejahen.
Dabei hat die überprüfende Behörde gemäss bundesgerichtlicher Rechtssprechung einen grossen Ermessensspielraum. Unterlässt sie dies, so unterschreitet sie das ihr gemäss der Gesetzgebung zustehende Ermessen, was eine Rechtsverletzung darstellt (Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Zürich VB.2012.00506 vom 8. November 2012 E. 6.3). Die Behörde ist also dazu verpflichtet, eine potentielle Selbst- oder Drittgefährdung zu überprüfen und auszuschliessen, bevor sie einen WES bewilligt.
Zuständigkeit und Vorgehen
Zuständig für die Überprüfung, ob die Voraussetzungen für den Waffenerwerb erfüllt sind, ist die Behörde im Wohnsitzkanton der gesuchsstellenden Person (Art. 9 WG i.V.m. Art. 15 Abs. 3 WV). Welche Behörde zuständig ist, richtet sich nach kantonalem Recht (BBl 1996 I 1061, vgl. auch Art. 38 Abs. 1 WG). In der Regel sind das die Gemeinde- oder Stadtpolizeien. Wie diese bei der Überprüfung des Hinderungsgrundes nach Art. 8 Abs. 2 lit. c WG vorzugehen haben, ist nicht im WG geregelt. Im vorliegenden Fall war die Kantonspolizei zuständig für die Überprüfung. Zudem stützte sich die Polizei bei der Anordnung des Gesprächs zwecks Bewilligung des WES auf kantonales Recht, nämlich das “Loi sur la procédure administrative” (LPA-VD) vom 28. Oktober 2008. Dieses Gesetz regelt allgemein das Verfahren vor den Verwaltungsbehörden der Kantone und Gemeinden des Kantons Waadt (Art. 1 LPA-VD). Art. 29 LPA-VD sieht ausdrücklich zwecks Tatsachenfeststellung ein Gespräch mit der gesuchsstellenden Person sowie ein Augenschein vor Ort vor. Art 30 LPA-VD hält ausdrücklich die Mitwirkungspflicht der gesuchsstellenden Person und die Folgen, wenn sie dieser nicht nachkommt, fest.
Prüfung kantonalen Rechts durch das Bundesgericht
Das Bundesgericht musste im vorliegenden Urteil also prüfen, ob das kantonale Recht korrekt angewendet wurde. Das Bundesgericht prüft kantonales Recht grundsätzlich nur auf Willkür; auch hat die Beschwerdeführerin keine Verletzung von Grundrechten geltend machte. Es beurteilt also nicht, ob eine kantonale Anwendung des Rechts möglicherweise falsch ist, sondern nur, ob sie willkürlich ist. Willkür liegt vor, wenn ein Entscheid im krassen Widerspruch zur tatsächlichen Situation steht, eine Norm oder einen Rechtsgrundsatz massiv verletzt oder dem Gerechtigkeitsgedanken zuwiderläuft. Es reicht nicht aus, dass die Begründung der Entscheidung unhaltbar ist; sie muss auch in ihrem Ergebnis willkürlich sein (BGE 149 I 329 E. 5.1; 145 II 32 E. 5.1).
Im Resultat erachtete das Bundesgericht das Gespräch als ein taugliches Mittel, den Hinderungsgrund in Art. 8 Abs. 2 lit. c WG zu überprüfen. Der Hausbesuch durch die Polizei bei der Beschwerdeführerin wurde auch nicht von vornherein angeordnet, sondern wäre lediglich in Betracht gezogen worden, hätte das Gespräch Anlass dazu geben. Da sie aber ihrer im kantonalen Recht vorgesehenen Mitwirkungspflicht nicht nachgekommen ist und das Gespräch von Anfang an verweigerte, handelte die Kantonspolizei korrekt, indem sie ihr keinen WES auststellte.
Die Kantonspolizei begründete die Anordung des Gespräches mit dem jungen Alter der Beschwerdeführerin. Bei besonders jungen Personen sei “erfahrungsgemäss” ein höheres Risiko der Selbst- oder Fremdgefährdung durch Schusswaffen gegeben. Allfällige Zweifel liessen sich im Rahmen eines persönlichen Treffens ausräumen. Ein Gespräch bei der Polizei scheint nicht auf jeden Fall vor Bewilligung eines WES vorgesehen zu sein.
Fazit
Von einer krassen Verletzung der Privatsphäre, wie PROTELL behauptet, kann also keine Rede sein. Der Besuch zu Hause ist nur vorgesehen, wenn das vorgängige Gespräch dazu Anlass gibt. Dieses wurde im Hinblick auf das junge Alter der Beschwerdeführerin und das damit einhergehende erhöhte Risiko einer Selbst- und Fremdgefährdung angeordnet. Diese Begründung ist auch der einzige Punkt in diesem Urteil, der etwas stutzig macht: Es findet sich keine Begründung, z.B. statistische Daten, warum junge Personen ein erhöhtes Risiko zur Selbst- oder Drittgefährdung durch den Erwerb einer eigenen Schusswaffe haben sollen.
Vor Bundesgericht machte die Beschwerdeführerin denn auch keine Verletzung von Grundrechten geltend, etwa das Recht auf Schutz der Privatsphäre (Art. 13 BV), was aber auch nachvollziehbar ist, denn der Hausbesuch wurde nie angeordnet, sondern nur in Aussicht gestellt, falls das Gespräch dazu Anlass gegeben hätte. Da sie keine Grundrechtsverletzung geltende machte, nahm das Bundesgericht lediglich eine Willkürprüfung vor. Das Bundesgericht betonte im Urteil auch ausdrücklich, dass ein solcher Hausbesuch selber verhältnismässig sein muss. PROTELL befürchtet, dass eine “uniformierte Kontrolle” durchgeführt werden würde. Erfahrungsgemäss ist dies nicht der Fall; die Polizei führt Kontrollen in privaten Räumlichkeiten im Zusammenhang mit legalem Waffenbesitz in der Regel in zivil durch. Ebenfalls gestützt auf kantonales Recht ist es sowieso möglich, dass die Polizei jederzeit kontrollieren kann, ob ein Waffenbesitzer die Voraussetzungen des Waffengesetzes erfüllt.
Ein vorgängiges Gespräch scheint ein taugliches Mittel um festzustellen, ob bei einer Person kein Hinderungsgrund gemäss Art. 8 Abs. 2 lit. c WG vorliegt und wird nicht nur im Kanton Waadt, sondern auch in anderen Kantonen - etwa Schaffhausen - praktiziert: Auch ich wurde - bevor ich meinen ersten WES erhielt - von der Polizei zu einem Gespräch eingeladen. Es war ein angenehmer Austausch mit dem damals zuständigen Polizeibeamten. Als Waffenbesitzerin und Sportschützin liegt es auch in meinem Interesse, dass die Behörden sorgfältig abklären, ob bei einer Person Anhaltspunkte vorliegen oder konkrete Hinweise dafür bestehen, dass keine Gewähr für einen sorgfältigen und verantwortungsbewussten Umgang mit der Waffe gegeben ist und deshalb Dritte gefährdet sind.
Insofern ist das Urteil korrekt und stellt Waffenbesitzer nicht unter “Generalverdacht”, wie von PROTELL behauptet.